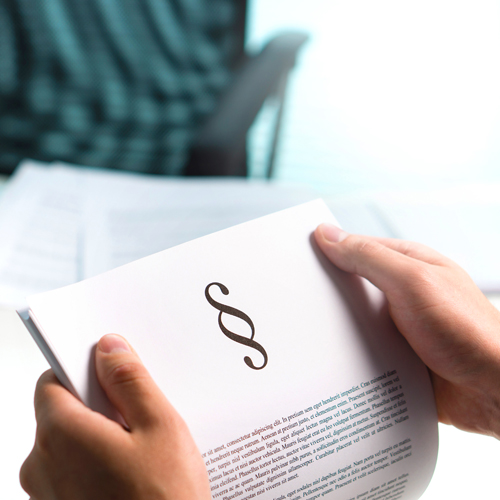09.04.2019
Welchen Einfluss hat das Interieur eines Fahrzeugs auf Markenbindung und Kaufentscheidung? Und wie können Automobilhersteller psychologische Faktoren bei der Entwicklung gezielt berücksichtigen? Unsere Kollegin Tanja Flügel vom Cluster Automotive bei Bayern Innovativ hat mit Prof. Dr. Claus-Christian Carbon, Leiter des Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg, über das Innenleben eines Autos aus dem Blickwinkel eines Psychologen gesprochen.
 Automobilhersteller nutzen Psychologie, um die Entwicklung des Fahrzeuginterieurs an den Kundenbedürfnisse auszurichten. (Bildnachweis: BMW Group)
Automobilhersteller nutzen Psychologie, um die Entwicklung des Fahrzeuginterieurs an den Kundenbedürfnisse auszurichten. (Bildnachweis: BMW Group)
Was hat das Interieur eines Fahrzeugs mit Psychologie zu tun?
Herr Prof. Carbon, Psychologie und der Innenraum eines Autos haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Oder doch?
Prof. Dr. Claus-Christian Carbon: Oft erscheinen Innenraumdesigns vor allem als ingenieurwissenschaftlich relevant. Dabei wird aber übersehen, dass Nutzer und Käufer am Ende Menschen sind. Ihre Eigenarten, Vorlieben und spezifischen Akzeptanzen, Innovationen zu verstehen, ist essenziell. Um objektiv messbar zu machen, was andere Fachbereiche eher in spekulativer Weise als gegeben ansehen, benötigen wir psychologische Theorien und konkrete Methoden aus der kognitiven Psychologie. Es geht um echte empirische Erkenntnisse, aus denen klare Handlungsanweisungen abgeleitet werden können.
Psychologische Methoden identifizieren Kundenwünsche
Kann man denn wirklich messen, was für den Nutzer im Fahrzeuginnenraum relevant ist?
Prof. Dr. Claus-Christian Carbon: Die größte Herausforderung ist, ein Bild zu erhalten, was der Nutzer will, was er wahrnimmt und welche Assoziationen er zieht. In Bamberg entwickeln wir ausdifferenzierte Techniken, mit denen die erforderlichen Daten nachvollziehbar und umfangreich gemessen werden können. Sogenannte „Topografische Relevanzfeldkarten” ermöglichen beispielsweise via Augen- und Handbewegungsanalysen, weitreichende Aufschlüsse über die primär relevanten Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Aus diesen kann die Industrie entsprechende Schlüsse ziehen, um Produkte zu perfektionieren oder Qualitätsoffensiven auszurichten.
Und wie sehen diese Methoden konkret aus?
Prof. Dr. Claus-Christian Carbon: Wichtig ist, immer ganz spezifische Messmethoden für die jeweilige Fragestellung zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Automobilhersteller zum Beispiel am differenzierten Eindruck des Kunden hinsichtlich des Innenraums interessiert ist, verwenden wir einen eigens dafür von uns entwickelten standardisierten Fragebogen – den sogenannten Car-IDQ (Anm. d. Red.: Car-Interior Design Questionnaire). Sind dagegen sehr spontane Urteile von Interesse, verwenden wir zum Beispiel den multidimensionalen impliziten Assoziations-Test md-IAT, eine von uns entwickelte und zertifizierte Technik, um automatische, assoziative Anteile zu identifizieren.
Wie objektiv sind Aussagen darüber, welche Assoziationen das Interieur weckt?
Prof. Dr. Claus-Christian Carbon: Mit ehrlichen Meinungen ist es bei wissenschaftlichen Untersuchungen eine ähnliche Herausforderung wie im Alltag. Menschen, die zu stark am Entstehungsprozess eines Produkts beteiligt waren, können nicht mehr „objektiv” urteilen, anderen fehlt die Differenzierung und sie können sich oft nicht richtig auf innovative Designs einlassen. Andere wiederum wollen schlichtweg nicht preisgeben, was sie wirklich denken. Um aus dieser Herausforderung einen methodischen Ausweg zu finden, haben wir eine Reihe von Methoden entwickelt. Einerseits machen wir befragte Personen erst einmal systematisch mit den zu bewertenden Materialien vertraut. Diese Repeated Evaluation Technique hat sich im Industriekontext hervorragend bewährt, um innovative Produkte zu testen. Zum anderen setzen wir sogenannte implizite Messverfahren wie den md-IAT ein. Der Vorteil solcher Methoden ist es, dass die Urteile nicht direkt, also „explizit” erfragt werden, sondern indirekt durch Reaktionszeitunterschiede beim Assoziieren von Konzepten und Produkten berechnet werden. Also „implizit”. Dies ist eine äußerst spannende Technik, bei der wir reale Urteile und Einstellungen gegenüber einem Soll vergleichen können, das wir für bestimmte Marken, Produktkategorien oder Produktlinien festlegen, um dann konkrete Handlungsschritte aufzuzeigen – also welche Parameter müssen im Design verändert werden, was muss im Verkauf beachtet werden und wie muss das damit verbundene Marketing geartet sein.
Markenerkennung am Design des Fahrzeuginterieurs
Welche Rolle spielt die Marke bei der Kaufentscheidung?
Prof. Dr. Claus-Christian Carbon: Wir alle wissen, dass eine Marke einen starken Bezugsrahmen schafft. Daher ist es wichtig, Marken erkennbar zu machen. Logos und Schriftzüge sind für starke Marken natürlich nicht genug. Wesentlich ist, eine markenspezifische Formensprache zu entwickeln und konsequent weiterzuführen. Dafür benötigen wir eindeutiges Wissen darüber, an welchen Elementen oder Konfigurationen typische Kunden die Marke erkennen. Sie direkt danach zu fragen, ist meist ein sinnloses und naives Unterfangen. Auch hier benötigen wir spezifische Methoden, die das, was ein Kunde eben nicht klar beschreiben kann, objektivierbar machen. Mit der von uns entwickelten IMUDE-Technik (Anm. d. Red.: Identification Machine for Unique Design Elements) bitten wir typische Nutzer in schneller Abfolge spontan zu beurteilen, welcher Marke bestimmte Produkte angehören. Die gezeigten Produkte werden extrem undeutlich gezeigt, vergleichbar mit ungünstigen Sehbedingungen. „Zufälligerweise” werden einzelne Teile deutlicher angezeigt. Wenn wir nun mit unserem Algorithmus alle richtigen Antworten sammeln, ergibt sich ein faszinierendes Endresultat. Die Durchgänge, bei denen sich die Kunden in ihrem Urteil nicht sicher waren, bei denen die Kunden also schlichtweg geraten haben, mitteln sich statisch gesehen aus. Alle Durchgänge dagegen, in denen die Kunden tatsächlich einzelne für eine Marke charakteristische Designelemente erkannt haben, zeigen mit steigender Anzahl der Durchgänge immer stabilere Muster auf. Kurzum, wir erhalten ein grafisches Bild, das diese wichtigen Designelemente sichtbar macht. Die Methode zeigt eindrucksvoll, wie die Psychologie die Industrie unterstützen kann, neue Designvorschläge kritisch zu prüfen.