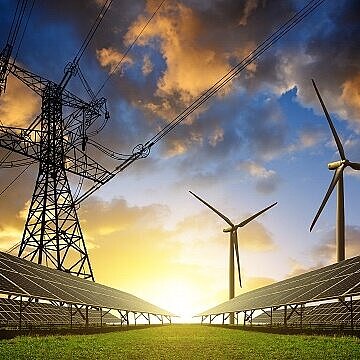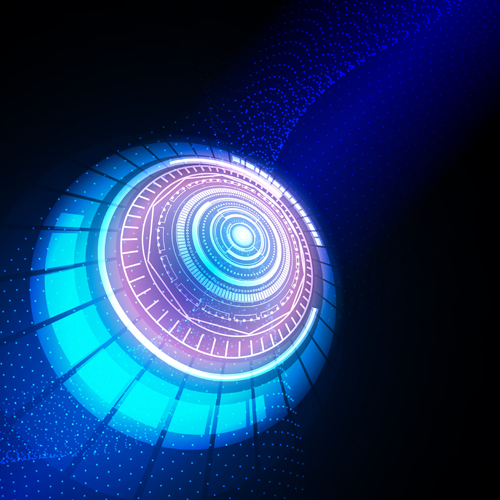Wie das Bayernwerk die Energiewende smart integriert
Bayernwerk präsentiert neue Digital- und KI-Lösungen für ein schnelleres, stabiles Energiesystem
13.11.2025
Quelle: E & M powernews
Innovationen, Digitalisierung, KI – zwingende Voraussetzungen, um die Energiewende voranzubringen. Das ist für Bayernwerk-Chef Leo Westphal klar. Vor allem, wenn es schnell gehen muss.
Was man bei der Eon-Tochter Bayernwerk so alles ersonnen hat, um die Umstellung auf erneuerbare Energieträger und vor allem deren Integration ins Stromnetz zu beschleunigen und zu erleichtern, das hat der Energieversorger beim „InnoDay“ am Unternehmenssitz in Regensburg vorgestellt.
Der Bayernwerk-Vorstandsvorsitzende Egon Leo Westphal zeigte bei der Veranstaltung die enormen Veränderungen auf, die das Energiesystem in den vergangenen Jahren nicht nur im Freistaat erlebt hat: An sonnenreichen Tagen müssen bis zu 13.400 MW Einspeisung im Netzbetrieb gemanagt werden. Bis zu 7.000 MW – mehr als die maximale Verbrauchslast Bayerns – werden an solchen Tagen ins europäische Übertragungsnetz abgegeben. Zugleich verwies er auch auf die Probleme, die damit einhergehen, dass der Fortschritt bei der Energiewende lange Zeit nur an der Zahl der Erneuerbaren-Einspeiseanlagen festgemacht wurde. Das sei vorbei, heute müsse es darum gehen, nach den Erneuerbaren die Energienetze und das ganze Energiesystem zu entfesseln. „Unsere technologische Innovationskraft ist entscheidend, um das Energiesystem von morgen in Balance und damit so richtig ins Laufen zu bringen.“ Nur dann werde die Energiewende zum Erfolg und könne die Potenziale für die Menschen vollumfänglich ausspielen.
Alle Komponenten des Systems zusammenbringen
Weiter sprach Westphal die hohen Investitionen seines Unternehmens in den Netzaus- und -umbau an. In den Jahren 2025 und 2026 werden demnach kumuliert mehr als 4 Milliarden Euro zusammenkommen. „Um am Ende alle Komponenten des Systems zusammenzubringen, braucht es Innovationen und kreative Ideen“, so der Vorstandsvorsitzende. Und welche das sind, zeigte das Unternehmen jetzt beim Innovationsparcours, der in der Regensburger Zentrale aufgebaut war.
- Da sind zunächst die „Local Energy Communities“. Hinter ihnen steckt die Idee, dass Strom regional erzeugt und auch verbraucht wird – was nicht nur den Netzen gut tut, sondern auch dem Geldbeutel der Verbraucher. Diese bekommen nämlich über eine Software die Zeiten mit den günstigsten Strompreisen angezeigt und können sie auch nutzen. Im Landkreis Bamberg läuft ein entsprechendes Pilotprojekt.
- Überbauung und „Snap“ sind weitere zukunftsweisende Ansätze zur Integration der Erneuerbaren. Das Vorhaben zielt darauf ab, die in Bayern schon reichlich vorhandenen Netzanbindungen für Solaranlagen gleichzeitig für Windräder zu nutzen. Damit, so hat man ausgerechnet, ließen sich 4.900 MW Windstrom zusätzlich ins Netz integrieren. Wie Untersuchungen gezeigt haben, machen sich Wind und Sonne bei der Einspeisung kaum Konkurrenz.
- Und die Snap-Software hilft dabei, die Player, also PV-Anlagen-Besitzer, Windmüller und Netzbetreiber schnell zusammenzubringen: Mussten früher unzählige Formulare hin- und hergeschickt werden, lassen sich jetzt alle Informationen schnell am PC abrufen und vor allem austauschen. Basis ist das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur.
- Umspannwerke im Container. Weiteres Nadelöhr der Energiewende: Umspannwerke. Hunderte muss das Bayernwerk neu bauen. Auch hier soll es jetzt schneller gehen. War früher jede Anlage ein Unikat, so sollen sie jetzt von der Stange kommen. Container-Umspannwerke sind angesagt. Sie sind kompakt, auf 13 Meter kann eine komplette 110-kV-Anlage untergebracht werden: eine Flächeneinsparung von 85 Prozent. In erster Linie kommen sie zum Einsatz, um Engpässe während Bauarbeiten zu überbrücken, eine Art Bypass. Drei Projekte laufen bereits.
- Bei weiteren innovativen Projekten geht es vorwiegend darum, Informationen aus dem Netzbetrieb zu gewinnen und sie vorteilhaft zu verwerten. Ein Beispiel sind die Heimdall-Sensoren, die direkt auf Hochspannungs-Leiterseilen installiert werden und die verschiedensten Betriebsdaten liefern. Mit dem Effekt, dass sich eine Freileitung schon mal um 40 bis 50 Prozent höher belasten lässt, als die Hersteller es angeben. Diese sind für Worst-Case-Szenarien ausgelegt. Aktuell wird die Belastung von zehn Trassen mithilfe der Sensoren überwacht und gesteuert. Bis Ende 2026 sollen es 40 sein.
- Auch im Bereich der Ortsnetzstationen gibt es Projekte zur intelligenten Steuerung, darüber hinaus innovative Überwachungssysteme, die Fehlerstellen im Bereich der Hoch- und Mittelspannung erkennen können und so eine rechtzeitige Reparatur ermöglichen – im besten Fall vor einem Ausfall.
Autor: Günter Drewnitzky
Das könnte Sie auch interessieren
Bayern Innovativ Newsservice
Sie möchten regelmäßige Updates zu den Branchen, Technologie- und Themenfeldern von Bayern Innovativ erhalten? Bei unserem Newsservice sind Sie genau richtig!