Gebärmutterhalskrebs: Wenn Vorsorge den Unterschied macht
29.01.2026
Jedes Jahr im Januar erinnert der Gebärmutterhalskrebs-Awareness-Monat daran, der eigenen Gesundheitsvorsorge besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ihren Ursprung hat die Initiative in den USA, wo sie 2009 politisch verankert wurde, um das öffentliche Bewusstsein für Gebärmutterhalskrebs nachhaltig zu stärken. Der Grund dafür ist ernst: Gebärmutterhalskrebs, auch Zervixkarzinom oder Kollumkarzinom genannt, zählt weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen und wird fast ausschließlich durch Humane Papillomviren (HPV) ausgelöst. In diesem Zusammenhang gilt es im Blick zu behalten: Alle Geschlechter können diese Viren übertragen und sich damit infizieren.
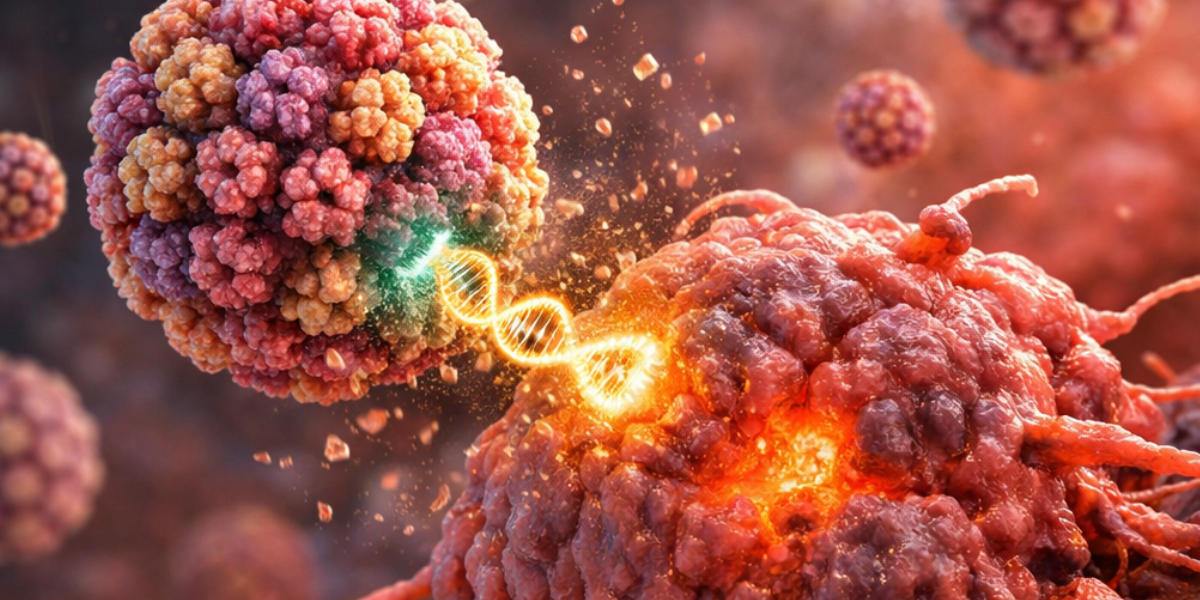
HPV-Infektionen als Hauptursache
Im Laufe des Lebens infizieren sich 85 bis 90 Prozent aller sexuell aktiven Menschen mit HPV. Infektionen verlaufen häufig symptomlos, weshalb das Bewusstsein für deren Verbreitung und mögliche Folgen oft fehlt. In den meisten Fällen wird das Virus innerhalb von ein bis zwei Jahren vom Immunsystem eliminiert. Persistiert die Infektion jedoch, kann sie zu Zellveränderungen führen. Diese Zellveränderungen können sich in gutartigen Läsionen zeigen, sich aber auch zu Krebsvorstufen oder invasiven Tumoren entwickeln. Vorsorge spielt daher eine entscheidende Rolle.

„Es gibt die Patientinnen, die sich selbst überhaupt nicht haben vorstellen können, dass sie an Gebärmutterhalskrebs erkranken könnten. Das sind Patientinnen, die einfach mit so einem Optimismus ins Leben gehen, der eigentlich sehr zu befürworten ist, aber der dann eben eine gewisse Blindheit vor dem Risiko einer Erkrankung mit sich führt und deswegen die Vorsorgeuntersuchungen und Abstriche nicht gemacht worden sind“,
weiß PD Dr. med. Julius Emons, leitender Oberarzt der Frauenklinik am Universitätsklinikum Erlangen. Zwar gebe es in Deutschland ein gut strukturiertes und vollständig finanziertes Vorsorgesystem, „aber wir sehen Lücken in der Umsetzung“, so Emons. Dazu gehörten Frauen, die Vorsorgeuntersuchungen gar nicht wahrnehmen, ebenso wie Patientinnen, bei denen auffällige Befunde nicht konsequent weiterverfolgt werden. Beides könne dazu führen, dass Erkrankungen erst in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert werden.
„Wenn man an Gebärmutterhalskrebs denkt, sind es leider häufig junge Patientinnen, die mit einer Erkrankung kommen“, sagt Emons. „Einer Erkrankung, die vermeidbar gewesen wäre, wenn wir es schaffen würden, dass alle Patientinnen die Vorsorgeuntersuchungen und besonders auch die Impfung, die es gibt, wahrnehmen würden“, führt er weiter aus. Besonders belastend sei, dass viele Frauen mitten im Leben stehen, bereits Kinder haben oder sich noch in der Familienplanung befinden. „Es handelt sich also keineswegs um eine seltene Ausnahme, sondern um eine Erkrankung, die wir im Klinikalltag regelmäßig sehen“, stellt Emons fest.
Vertrauen schützt nicht, Kontrolle ist besser
Der Pap-Abstrich ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil der Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung. Durch den Zellabstrich vom Gebärmutterhals können Zellveränderungen oder Krebsvorstufen frühzeitig erkannt und eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden. Seit 2020 wird diese Methode durch den HPV-Test ergänzt und insbesondere bei Frauen ab 35 Jahren im Rahmen des Screenings eingesetzt.
In Deutschland erhalten Frauen von 20 bis 34 Jahren den Pap-Abstrich einmal pro Jahr, während Frauen ab 35 alle drei Jahre einen kombinierten Test aus Pap-Abstrich und HPV-Test bekommen. Statistisch gesehen kommen HPV-Infektionen bei jüngeren Frauen zwar häufiger vor, diese heilen aber schneller und ohne schwere Folgen aus. Bei älteren Frauen kann ein positiver HPV-Test jedoch ein Hinweis auf eine langanhaltende HPV-Infektion sein.
„Die Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung unterscheidet nach Altersgruppen und Risikoprofilen. Wichtig ist nicht, welcher Test wann durchgeführt wird, sondern dass die Vorsorge insgesamt ernst genommen wird – ebenso wie die Nachsorge bei auffälligen Befunden“, betont Emons. Mehr Untersuchungen in kürzeren Abständen bedeuteten dabei nicht automatisch mehr Sicherheit. Ein regelhaft unauffälliger Co-Test biete über mehrere Jahre eine sehr hohe Aussagekraft.
Parallel entwickeln sich diagnostische Verfahren kontinuierlich weiter. Der Mehrwert moderner Diagnostik liegt dabei insbesondere in der besseren Differenzierung von Befunden. Julia Sauer, Marketing Manager Molecular Solution bei Roche Diagnostics Deutschland GmbH, nennt hier u. a. die erweiterte HPV-Genotypisierung. Diese verspricht eine noch präzisere Risikoeinschätzung, da sich damit nicht nur das Vorliegen einer Hochrisiko-Infektion feststellen lässt, sondern zugleich die konkret beteiligten HPV-Typen identifiziert werden können. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der digitalen Pathologie gewinnt an Bedeutung, um auffällige Zellveränderungen zu identifizieren und zu klassifizieren. Zytologische Biomarker-Tests untersuchen zudem das Zellmaterial auf körpereigene Stoffe, die spezifisch in Krebszellen oder deren Vorstufen vorkommen.

„Ein klassischer HPV-Test zeigt lediglich, ob eine Infektion mit Hochrisiko-Typen vorliegt, sagt aber noch nichts über eine tatsächliche Erkrankung aus“,
ordnet Sauer ein. Biomarker-basierte Tests bieten hier Sicherheit und unterscheiden zwischen einem bloßen Infektionsverdacht und einer tatsächlichen krankhaften Veränderung.
Mit Blick auf die Zukunft sieht Sauer das HPV-Self-Sampling als Gamechanger. Durch die Selbstentnahme könnten Barrieren wie Scham oder Zeitmangel abgebaut werden. Diese Meinung teilt auch Prof. Dr. med. Marion Kiechle, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde am TUM Klinikum Rechts der Isar: „Der HPV-Selbsttest könnte meines Erachtens auch eine Maßnahme sein, in Deutschland die Bereitschaft zu erhöhen und die Frauen zu erreichen, die nicht regelmäßig zur Vorsorge gehen. Wenn man ihnen den Test zuschickt – einige Krankenkassen in Deutschland machen das bereits in einem Modellvorhaben – könnte man eventuell die Teilnahmerate erhöhen.”
HPV-Impfung: effektive Prävention mit Nachholbedarf
Seit 2006 steht mit der HPV-Impfung eine wirksame prophylaktische Maßnahme zur Verfügung, um HPV-assoziierten Krebserkrankungen vorzubeugen. Idealerweise erhalten Mädchen und Jungen die Impfung im Alter von 9 bis 14 Jahren vor dem ersten Sexualkontakt, denn

„Männer sind genauso Überträger wie Frauen auch. Sie können ebenso beispielsweise an Peniskarzinom oder Larynxkarzinom erkranken”,
erklärt Kiechle.
Doch die Impfquote in Deutschland liegt weiterhin deutlich unter der EU-Zielmarke. Im Jahr 2023 waren in Deutschland 55 Prozent der 15-jährigen Mädchen und 34 Prozent der 15-jährigen Jungen vollständig geimpft. Bis 2030 soll bei den 15-jährigen Mädchen eine Impfquote von 90 Prozent erreicht werden.
„Die HPV-Impfung ist ein riesiger medizinischer Erfolg“, so Emons. Die Wirksamkeit sei wissenschaftlich eindeutig belegt und Daten aus Ländern mit hohen Impfquoten zeigten, dass HPV-assoziierte Zervixkarzinome dort deutlich zurückgehen. „In einer idealen Welt, würden diese Krebserkrankungen durch die Impfung langfristig sogar ganz verschwinden“, führt Emons weiter aus.
Die Gründe für die niedrigen Impfquoten sieht Emons weniger in medizinischen Bedenken als in praktischen und kommunikativen Hürden: fehlende feste Impftermine bei den U-Untersuchungen, Vorbehalte gegenüber Impfungen im Allgemeinen und eine teilweise falsche Wahrnehmung der HPV-Impfung als Sexualprävention statt als Krebsprävention. Hier braucht es wirksame Aufklärung.
Therapie heute: bewährte Strategien und neue Ansätze
Trotz Prävention und Früherkennung werden in Deutschland jährlich rund 4.400 Neuerkrankungen diagnostiziert. In frühen Stadien ist Gebärmutterhalskrebs häufig operativ gut behandelbar, während in fortgeschrittenen Stadien meist kombinierte Therapieansätze aus Strahlen- und Chemotherapie zum Einsatz kommen. Durch ein besseres Verständnis der Tumorbiologie sowie Fortschritte in der Bildgebung und operativen Technik konnten Behandlungsstrategien weiter individualisiert werden.
„Wenn die Erkrankung früh erkannt wird, können wir heute bei vielen jungen Frauen zum Beispiel fertilitätserhaltend operieren“, erläutert Emons. Das eröffne Patientinnen trotz Krebsdiagnose die Möglichkeit, später noch einen Kinderwunsch zu realisieren.
Neben klassischen Therapiesäulen gewinnen Immuntherapien zunehmend an Bedeutung. Ziel dieser Behandlungsansätze ist es, das körpereigene Immunsystem gezielt zu aktivieren und wieder in die Lage zu versetzen, Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen. Bei Gebärmutterhalskrebs kommen bereits Checkpoint-Inhibitoren zum Einsatz. Diese revolutionären Medikamente greifen in Mechanismen ein, mit denen Tumorzellen der Immunabwehr entgehen, und können so die Immunantwort gegen die Krebszellen verstärken.

Ulf Grawunder, PhD, CEO und Co-Founder der T-Curx GmbH, einer Ausgründung der Universität Würzburg, wirft einen Blick auf neue Therapieansätze - die sogenannten CAR-T-Zelltherapien. Bei der CAR-T-Zelltherapie werden körpereigene Immunzellen entnommen, gentechnologisch verändert und wieder zugeführt. Infolgedessen sind sie in der Lage, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen. Während CAR-T-Zellen bei bestimmten Blutkrebserkrankungen bereits hohe Heilungsraten erzielen, seien solide Tumoren wie der Gebärmutterhalskrebs deutlich komplexer. Tumoren könnten sich vor Immunzellen gezielt „unsichtbar“ machen oder deren Aktivität unterdrücken. Aktuell laufen erste klinische Studien, die prüfen, ob sich diese Therapieform langfristig auch für solide Tumoren nutzen lässt.
Aufklärung, Vorsorge und Innovation zusammendenken
Gebärmutterhalskrebs zählt heute zu den am besten vermeidbaren Krebserkrankungen. Dennoch zeigt die Realität, dass Vorsorgeangebote, die HPV-Impfung und das Wissen über diese Erkrankung noch nicht ausreichend genutzt werden. Der Awareness-Monat macht deutlich, wie wichtig es ist, medizinische Fortschritte mit Aufklärung und niedrigschwelligen Angeboten zu verbinden.
Durch innovative Technologien in Früherkennung, Diagnostik und Therapie eröffnen sich neue Möglichkeiten, Erkrankungen frühzeitig zu entdecken und Menschenleben zu schützen. Diese Möglichkeiten entwickeln sich kontinuierlich weiter und erfordern eine enge Vernetzung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure. Als starker Partner unterstützt das Netzwerk der Bayern Innovativ GmbH die Entstehung neuer, zukunftsweisender Lösungen und fördert den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis. So werden vielversprechende Ansätze nachhaltig in marktfähige Lösungen überführt, die medizinische Versorgung verbessert und der Standort Bayern als leistungsfähige Innovationsregion gestärkt. Der gemeinsame Einsatz für mehr Gesundheitsbewusstsein bildet dafür eine zentrale Grundlage.
Das könnte Sie auch interessieren
Bayern Innovativ Newsservice
Sie möchten regelmäßige Updates zu den Branchen, Technologie- und Themenfeldern von Bayern Innovativ erhalten? Bei unserem Newsservice sind Sie genau richtig!




