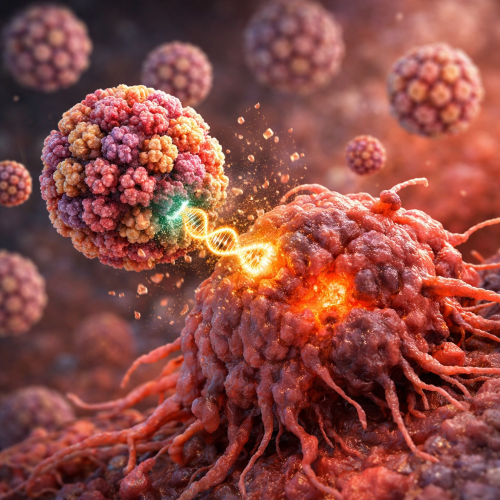Digitale Barrierefreiheit: Wie das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz digitale Türen öffnet
Digitale Inklusion als Innovationsmotor
23.07.2025
Ein Geldautomat, der sich nur per Touch bedienen lässt. Eine App, die Farben nutzt, aber keinen Kontrast bietet. Ein Online-Shop, den man ohne Maus nicht nutzen kann. Für viele Menschen mit Behinderung sind das alltägliche Barrieren – digitale Türen, die verschlossen bleiben. Doch damit ist nun Schluss: seit dem 28. Juni 2025 verpflichtet das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz viele Unternehmen dazu, ihre digitalen Produkte zugänglich zu machen. Was genau das bedeutet, warum Barrierefreiheit mehr ist als gesetzliche Pflicht – und wie sie zum Innovationsmotor werden kann –, erklärt Annett Farnetani, CEO der mindscreen GmbH. Sie berät Unternehmen zu digitaler Inklusion und weiß, warum jetzt der richtige Moment ist, umzudenken.

Worum geht es genau bei Barrierefreiheit im Unternehmenskontext?
Annett Farnetani: Unser höheres Ziel ist, dass wir alle digitalen Produkte zugänglich machen für so viele Menschen wie möglich. Und da gibt es natürlich jede Menge Barrieren, die auftreten. Wenn wir davon ausgehen, dass es die großen vier gibt, dann wären das die Sehbehinderungen, also beispielsweise jemand, der blind ist, aber auch die motorischen Behinderungen. Zum Beispiel jemand, der Schmerzen im Arm hat oder vielleicht sogar einen Arm verloren hat. Oder wir haben Personen, die kognitive Behinderungen haben, dazu zählen auchr Autismus-Spektrums-Störungen. Und wir haben auch auditive Behinderungen, also Personen die gehörlos, schwerhörig oder taub sind. Das heißt, wir haben eine breite Menge, die wir alle bedienen müssen. Da kommen manchmal auch Kombinationen dieser Barrieren zusammen. Das heißt, es gibt ganz viele Personen, die wir mit einem digital barrierefreien Produkt ansprechen, aber gleichzeitig haben wir sehr viel mehr Produkte, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Es ist nicht nur die Website. Gerade im Unternehmenskontext haben wir Applikationen, Dokumente, E-Mails, Newsletter und so weiter. Wir haben vielleicht auch Kiosk Systeme, das heißt zum Beispiel Geräte, die dastehen und mit denen man navigieren muss.
Warum ist Ihrer Meinung nach die Barrierefreiheit ein wichtiger Skill für die Zukunft?
Annett Farnetani: Wir haben manchmal dieses Bild von unserer Zukunft aus Science-Fiction-Serien oder ähnlichem. Da sehen wir große weiße Flächen, viel Glas, Menschen, die sich dort fortbewegen. Meistens sehen wir aber keine älteren Menschen, was doch sehr überraschend ist, wenn wir sehen, welche Überalterung wir haben und in welche Richtung wir gehen. Also Themen wie Longevity, wir sagen wir leben länger, was bedeutet, dass es auch mehr ältere Menschen gibt. Im besten Fall bleiben wir länger gesund, aber es wird vermutlich auch ganz viele geben, die eine Barriere erleben werden oder im Laufe ihres Lebens eine Erkrankung oder Behinderung erfahren werden. Das heißt, wir haben eine Entwicklung in der Gesellschaft, die Barrierefreiheit unbedingt als Basis braucht, damit wir in unsere Zukunft auch weiterhin digitale Produkte nutzen können.
Und was müssen Unternehmen tun, um digital inklusiv zu sein?
Annett Farnetani: Da gibt es ganz viele Aspekte. Sie müssen jetzt anfangen, dieses Thema aufzunehmen. Es hilft nichts, es irgendwann anzugehen, denn es ist wichtig, sich dem Thema ab jetzt anzunehmen und es als Teil der Unternehmens-DNA aufzunehmen. Sie gehen jetzt neue Projekte an, machen neue Produkte, entwickeln vielleicht etwas Neues mit KI, oder eine neue Innovation, und da sollten sie von Anfang an das Thema Barrierefreiheit mit aufnehmen. Oft reicht es nur, wenn irgendjemand im Team sagt: „Und was ist denn mit der digitalen Barrierefreiheit, was ist mit der Zugänglichkeit für alle?“ Dann kommt meist schon etwas in Gange. Damit hat das Produkt schon den ersten Schritt gemacht, zugänglich für alle zu werden. Von Anfang an mitzudenken ist sehr wichtig für das Thema.
Am 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft, was heißt das für Unternehmen, was müssen sie tun und welche Missverständnisse entstehen vielleicht dabei?
Annett Farnetani: Unternehmen, die unter das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz fallen, müssen ihre digitalen Produkte barrierefrei machen. Das ist meist das erste Missverständnis, dass man glaubt, alle Unternehmen müssen jetzt barrierefrei werden aufgrund des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, aber das stimmt nicht. Im Gesetz selbst ist klar definiert, welche Unternehmen mit welchen Dienstleistungen oder Produkten Barrierefreiheit umsetzen müssen. Tatsächlich geht es da um physische Produkte, die auch digitale Anteile haben, wie zum Beispiel E-Book-Reader oder Geldautomaten mit SB-Terminals, um ein paar Beispiele zu nennen. Und bei Dienstleistungen geht es zum Beispiel um Bankdienstleistungen. Es wird klar gesagt, was und wer Barrierefreiheit umsetzen muss, und das ist ein großer Irrtum. Den größten Bedarf sehen wir im Bereich der Onlineshops, also wo es zur geschäftlichen Anbahnung kommt. Das heißt, nicht nur klassische Onlineshops mit einem Warenkorb, sondern alles, wo geschäftliche Anbahnungen entstehen. Zum Beispiel bei Versicherungen, Mietungen, oder dem Verkauf von Workshops. Es gibt ein paar Ausnahmen für kleinste Unternehmen zum Beispiel, aber grundsätzlich ist es das Thema. Vorurteile, die in den Unternehmen herrschen sind einerseits, dass viele denken, dass 100% Barrierefreiheit nicht umsetzbar sind, deshalb wollen sie es lieber gleich seinlassen. Da wird dann angefangen zu diskutieren. Es werden Dinge gesagt, wie „Es geht ja gar nicht, die 100%. Müssen wir es nicht “Barrierearm” nennen?“ Das sehe ich als sehr schwierig an. Da ist ein klarer Standard dahinter, der umsetzbar ist, den man erfüllen kann. Es ist ein Mindeststandard. Hier geht es um Mindestanforderungen, um erstmal überhaupt etwas zugänglich zu machen, und es ist wichtig, überhaupt den Schritt zu machen. Das zweite Problem ist, dass das Thema digitale Barrierefreiheit im Unternehmen oft von einem Team zum nächsten geschoben wird und sich Personen entweder nicht verantwortlich fühlen oder es grundsätzlich gar nicht in ihrem Bereich sehen oder dass es von der Chefetage, oder vom Projektmanagement kein klares Commitment gibt. Es müssen alle machen und es ist eine Teamarbeit. Und das ist nicht nur Teil der Entwicklung, oder von der UX oder Qualitätssicherung, sondern alle müssen Barrierefreiheit umsetzen und es ist nicht möglich, diese Verantwortung von einem zum anderen zu schieben.
Was brauchen denn Projektteams, was brauchen Entwicklerinnen und Entwickler, Entscheiderinnen und Entscheider, um dieses Thema richtig anzugehen?
Annett Farnetani: Es sind tatsächlich die klassischen Aspekte, die man vermutlich bei jedem Projekt braucht. Zeit, Geld und das Commitment von oben, also dass jemand sagt: „ihr dürft das und es hat Priorität, es geht nichts raus, ohne dass es barrierefrei ist.“ Wenn wir von dem klassischen Website-Relaunch reden, dann wissen wir, wie diese Tickets schlussendlich liegenbleiben können und vermutlich nicht mehr in das Produkt reinkommen, wenn man das nicht als klaren Bug sieht oder als klaren Fehler, dass die Barrierefreiheit nicht eingehalten wurde. Das heißt, wir brauchen es auf jeden Fall, dass gesagt wird: „Ohne Barrierefreiheit geht es nicht raus, egal welche Sache.“ Es muss so also viel Wissen zusammengetragen werden und daher entscheiden sich auch viele, gerade große Unternehmen, für Dienstleistungsunterstützung. Das ist mehr wie ein Booster zu verstehen. Die haben das konkrete Wissen und damit kann man sein eigenes Team boostern, damit sie schneller vorwärtskommen und schneller das Wissen integrieren können. Man kann es aber auch ohne Unterstützung machen. Es gibt sehr viele Weiterbildungen, aber dann dauert es natürlich länger und man muss fehlertoleranter sein und einfach mehr Geduld aufbringen.

“Die Web Content Accessibility Guidelines sind letztes Jahr 25 Jahre alt geworden. Und trotzdem findet man die Vorgaben z. B. für Farbkontraste auf so wenigen Webseiten umgesetzt.”
Annett Farnetani
CEO, mindscreen GmbH
Was sind die typischen Fehler, die bei der Barrierefreiheit passieren können?
Annett Farnetani: Zum Beispiel, dass ein Produkt nicht mit Tastatur bedienbar ist. Das heißt, dass wir nicht mit der Tastatursteuerung, mit der Tabulatortaste, oder Enter- und Pfeiltasten alle interaktiven Komponenten anspringen und aktivieren können. Das heißt etwa, wenn wir eine Navigation anspringen, muss es zu öffnen und zu schließen sein, es muss alles aktivierbar sein. Ein anderes großes Thema, was sehr leicht zu lösen ist, rein vom Wissensstand her, sind die Farbkontraste. Gerade wenn die CI-Farben von dem Unternehmen vielleicht hellorange oder hellblau sind, dann ist es schwierig zu sehen. Da gibt es dann die Befürchtung, dass die Firmen hier ihr ganzes System ändern müssen, was ein großer Aufwand wäre. Da hängen viele Menschen und Freigabestellen mit drinnen, die das irgendwie bestätigen müssen, aber so ist es nicht gedacht. Man kann schon mit einem nicht ausreichend kontrastreichen CI arbeiten, solange die Farbe nicht als Wissensvermittlung oder als Inhaltsvermittlung eingesetzt wird. Das heißt, der Text darf nicht in hellgelb oder hellblau sein. Das ist beispielsweise ein typisches Problem, auf das wir am Anfang schauen müssen. Es sind aber auch grundlegende Programmier-Themen, die fehlen oder nicht gemacht werden, grundliegendes HTML, das nicht umgesetzt wird. Oft fehlen Alternativtexte, das ist der Klassiker. Hier muss man überlegen, dass die WCRG, (die Web Content Accessibility Guideline, die letztes Jahr 25 Jahre alt geworden ist) Vorgaben enthält, zum Beispiel wie hoch der Farbkontrast sein muss und wie die Tastatursteuerung geregelt ist. Und trotzdem ist es tatsächlich noch auf so wenigen Seiten umgesetzt.
Und welche Rolle spielt eine Plattform wie CAAT bei der ganzen Sache?
Annett Farnetani: CAAT ist direkt aus unserem Anspruch als Barrierefreiheitsdienstleister geboren. Einer der Hauptpunkte in der digitalen Barrierefreiheit ist das Testen. Wir kriegen ein Produkt und meistens ist der Start das Testen des Produkts. Dieser Testprozess ist sehr aufwendig. Es gibt keine automatische Lösung. Es gibt zwar Teile, die automatisch gelöst werden können, aber das meiste muss eine Person manuell testen und prüfen, die Empfehlungen schreiben und je nach Kontext auch anpassen, um zu schauen welche Lösung möglich ist. Es gibt immer verschiedene Lösungen. Um diesen Prozess so effizient und effektiv wie möglich zu gestalten, haben wir CAAT entwickelt. Von dem Katalog, nach dem man testet, über den Testprozess an sich, bis hin zur Ausgabe eines Berichtes, der dann gegebenenfalls in bestimmte Ticketsysteme exportiert werden kann, wollten wir das Drumherum so einfach wie möglich gestalten. Damit können sich Testende auf ihr Wissen und auf ihre Arbeit konzentrieren und zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten, die vielleicht nur bestimmte Prüfschritte im Teamtesten. Das war unser Ziel, dass auch die Testenden divers aufgestellt werden und mehr Menschen mit Behinderung in den Testprozess einbezogen werden.
Was empfiehlst Du Unternehmen, die mit der Barrierefreiheit starten wollen und selbst vielleicht keine Expertinnen und Experten dafür vor Ort haben?
Annett Farnetani: Da wäre es am einfachsten, sich ein Dienstleistungsunternehmen oder ein Beratungsunternehmen dazuzuholen, was einen auf dem Weg unterstützt. Gerade jetzt, da die Sache ab dem 28. Juni 2025 umgesetzt sein muss und sicherlich auch erste Prüfungen kommen, ist das jetzt eine sehr kurze Zeit, in der man alles umsetzen muss. Das eigene Team kann sich das Wissen natürlich aneignen, das ist möglich, es geht auch ohne externe Beratung. Es gibt genug Unterstützung im Web und auch Weiterbildungen, aber es dauert eben sehr lange und man muss sehr fehlertolerant sein. Ich sehe das so, dass man mit einem Dienstleistungsunternehmen, einfach einen Booster bekommt, um sich das Wissen schneller anzueignen. Dadurch verringert sich auch die Frustration im Team. Wenn man irgendwo festhängt, kann man dorthin gehen und sich helfen lassen. Wir haben zum Beispiel häufig die Frage nach dem Gendern für Screenreader, also wie Screenreader das aufnehmen. Das ist ein Punkt, den kann man auch im Netz recherchieren, aber dabei, den Kontext zu erstellen, ist ein Dienstleistungsunternehmen viel schneller, weil es mehr Erfahrung hat und das kennt. Wichtig ist es natürlich, gute Dienstleister zu finden. Wir haben einen großen Markt, das heißt es sind viele auf den Markt gekommen, die es anbieten und vielleicht gar nicht die nötigen Erfahrungen und das Wissen haben. Hier ist meine Empfehlung, zu Konferenzen zu gehen und sich Vorträge anzuhören. Es gibt sehr viel virtuelles Material, um zu schauen, wie die Leute auftreten. So kann man auch sehen, was für einen selbst und zum eigenen Unternehmen passt, um die richtigen Partner zu finden. Es gibt manche Unternehmen, die eher einen Überblick bekommen wollen, dass man bestimmte Prozesse ankurbelt, zum Beispiel eine Gap-Analyse, um zu sehen, wie der aktuelle Stand der digitalen Barrierefreiheit im Unternehmen und auch in verschiedenen Bereichen ist. Bei anderen Unternehmen kommen die Entwicklungsteams und sitzen mit uns zusammen, um einzelne Code-Schnipsel zu überarbeiten. Das geht von groß bis klein. Ein wichtiger Punkt, an dem man die Unterstützung meistens erneut braucht, ist in der Rechtsabteilung. Da wird es oft kombiniert, um besser zu sehen, welche Lösung passt und welche eher nicht.
Gibt es typische Fehler, die in Projektteams gemacht werden?
Annett Farnetani: Wir kriegen häufig die Anfrage, dass wir einen kompletten, umfassenden Barrierefreiheitstest machen sollen. Im schlimmsten Fall sind das dann Hunderte von Tickets, die aufkommen, also Hunderte von Fehlern, die alle in einem Paket an das Team übergeben werden und das Team erschlagen. Im besten Fall sind die Tickets so, dass verstanden wird, um was es geht. Aber ein Produkt wird nicht nur barrierefrei gemacht, es wird ja gleichzeitig auch an Features gearbeitet es wird weiterentwickelt. Das heißt, es wird vielleicht an einer Stelle schon wieder etwas gemacht, was dann im Test veraltet ist. Oft ist der Wunsch nach solchen kompletten Tests da, weil man denkt, man hat dann eine Art Checkliste, die man abhaken kann oder vielleicht, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Barrierefreiheit passiert nicht zufällig. Man braucht bestimmte Fähigkeiten und das ist ein großes Thema, bei dem auch Experten unterschiedlicher Meinung sind. Manche sagen, es ist besser mit so einem großen Test. Vielleicht ist das größte Problem, dass nicht genug Austausch besteht und dass nicht genug Beratung entsteht. Unternehmen können auch selbst vorgeben, was sie brauchen. Ein Test ist nicht gleich ein Test per se, das ist keine festgelegte Sache. Es muss miteinander geredet und herausgefunden werden, was für diesen Schritt gebraucht wird. Manchmal wird das wie ein Paket gesehen, nach dem Motto: „ich kaufe jetzt das Paket digitale Barrierefreiheit“, und das funktioniert nicht, weil jedes Unternehmen unterschiedlich ist und unterschiedliche Personen hat. Daher würde ich wie gesagt empfehlen, dass man da in den Austausch mit Spezialisten und auch in die jeweiligen Konferenzen geht und schaut, wie das zusammenpasst mit dem eigenen Unternehmen. Denn es wird eine längerfristige Beziehung werden. Ich rede hier von sehr großen Projekten. Meine zweite Empfehlung ist, wenn es um kleinere Projekte geht, zum Beispiel um eine Website, die man barrierefrei machen will, nicht zu versuchen, diese nachträglich barrierefrei zu machen. Wenn es möglich ist, sollte man sie neu launchen und von vornherein Barrierefreiheit einbringen. Unsere Erfahrung zeigt, dass es grundsätzlich genauso teuer wird oder eigentlich fast unmöglich ist, ein Projekt nachträglich barrierefrei zu machen, weil da einfach zu viel fehlt und zu wenig richtig gemacht wird. Es ist besser, die Konzeption von Anfang anzusetzen und sich zu überlegen, wieviel es kosten würde, das nachträglich zu machen und wieviel es kostet, wenn man es im Relaunch komplett neu ansetzt.
Sie haben bereits einige Technische Methoden und Werkzeuge angesprochen, welche Rolle spielt denn Empathie bei der Barrierefreiheit?
Annett Farnetani: Das liegt daran, dass wir erstmal versuchen, ein Produkt so weit hinzubekommen, dass es überhaupt von Menschen mit Behinderung genutzt wird. Empathie spielt natürlich eine Rolle, aber an dem Punkt, an dem wir aktuell mit der digitalen Barrierefreiheit sind, funktioniert so viel noch nicht oder ist noch nicht korrekt. Wir testen zum Beispiel auch SB-Terminals für Banken, da wollten wir so früh wie möglich Menschen mit Behinderung zum Testen hinzuziehen, aber das ging eben noch nicht, weil nichts funktioniert hat. Das heißt, beispielsweise ein blinder Mensch hätte davorgestanden und hätte gar nichts machen können, weil die Tastatursteuerung überhaupt nicht funktioniert hätte. Wir müssen erstmal einen ganzen Schritt gehen, um ein Produkt überhaupt „testable“ zu machen, sodass es überhaupt von Menschen mit Behinderung getestet werden kann. Was sehr gut funktioniert, ist es, jemanden dazuzuholen, gerade wenn man startet. Zum Beispiel, dass jemand zeigt, wie man einen Screenreader benutzt. Manche nennen das Sensibilisierung, man könnte es aber auch Empathie nennen. Es geht eben darum, dass man jemanden Betroffenes dazuholt, der oder die von seiner oder ihrer Erfahrung spricht. Manche glauben ja gar nicht, dass jemand, der blind ist, tatsächlich ein digitales Produkt benutzen kann. Und so sehen sie, wie das geht und dass es geht und welche Dinge im Weg liegen können, und das macht natürlich sehr viel aus.
Was kann die Barrierefreiheitskompetenz über das Gesetz hinaus leisten, beispielsweise für die Nutzerbindung, das Markenimage, oder die Innovationsfähigkeit?
Annett Farnetani: Für alle Bereiche. Ein Beispiel wäre das IPhone von Apple. Das ist ein barrierefreies Produkt, die Firma war dazu verpflichtet. Dieses Produkt ist begehrenswert, innovativ und es ist barrierefrei, es wird von ganz vielen Menschen verwendet. Hier kann man gut sehen, dass das Zusammenspiel funktionieren kann. Es gibt das Vorurteil, dass Barrierefreiheit nicht ästhetisch, sondern hässlich ist, das stimmt aber nicht. Auch mit den Vorgaben ist es möglich, ein gutes, attraktives und begehrenswertes Produkt zu machen. Wir sehen hier natürlich einen Imagegewinn. Das machen Firmen wie Apple oder Microsoft, die hier den Weg ebnen, zum Beispiel auch durch Inklusionstage, eben nicht nur nach außen, auch für die eigenen Mitarbeitenden. Wir sehen oft, dass gerade durch so eine Positionierung das Interesse hochgehalten wird. Auch für potenzielle Mitarbeitende. Wenn man davon ausgeht, dass die Firmen es ernst meinen. Für uns ist auch ein wichtiger Punkt, gerade weil wir auch viel für die Öffentlichkeit gearbeitet haben, ist, dass man die Digitalisierung supergut mit der Barrierefreiheit verbinden kann. Die beiden als Partner zu begreifen, die zusammen gehen und damit etwas Besseres zu schaffen, da sehen wir ein großes Potenzial. Ich finde, es ist nichts innovativ, wenn es nicht zugänglich für alle ist. Das klingt vielleicht streng, aber es muss eben von allen genutzt werden können, und deswegen ist die Barrierefreiheit eine Grundlage für die Innovation.
Was wäre Ihr Appell an die Wirtschaft und an die Gesellschaft?
Annett Farnetani: Man muss die Barrierefreiheit als einen Motor für Innovation betrachten und diesen Zugang als Chance nutzen und nicht als Problem sehen.
Das Interview führte Barbara Groll, Media Relations, Bayern Innovativ GmbH, Nürnberg.
Hören Sie sich das vollständige Interview als Podcast an:
Länge der Audiodatei: 00:24:16 (hh:mm:ss)
Future Skill Barrierefreiheitskompetenz: Digitale Teilhabe gestalten (18.06.2025)
Am 28. Juni 2025 tritt das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (kurz: BFSG ) in Kraft. Und damit wird der Anspruch auf Barrierefreiheit konkret und verpflichtend. Entsprechen Ihre digitalen Produkte bereits diesem Gesetz? Informieren Sie sich mit unserem Podcast und sichern Sie sich von unserem Talkgast, Annett Farnetani (CEO der mindscreen GmbH), wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung.
Ihr Kontakt


Das könnte Sie auch interessieren
Bayern Innovativ Newsservice
Sie möchten regelmäßige Updates zu den Branchen, Technologie- und Themenfeldern von Bayern Innovativ erhalten? Bei unserem Newsservice sind Sie genau richtig!