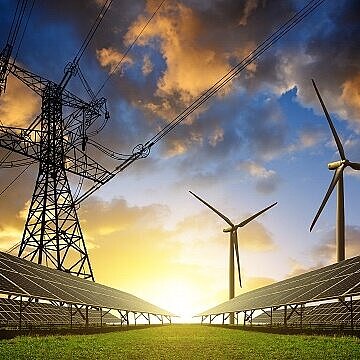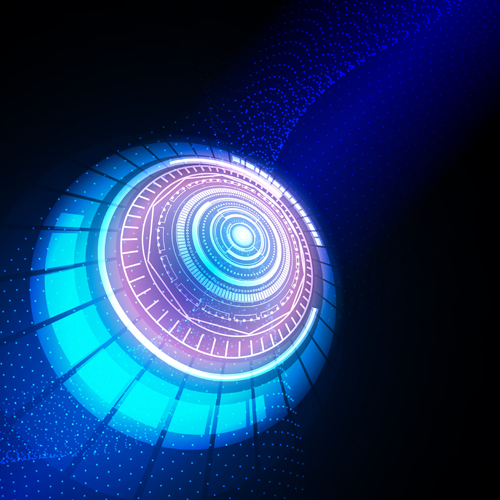Öffentliche Gebäude sehr ungleich für PV genutzt
Analyse von Viessmann Climate Solutions zeigt große Unterschiede beim Solarausbau auf öffentlichen Gebäuden – Baden-Württemberg und Hessen führen, viele Städte hinken hinterher
28.11.2025
Quelle: E & M powernews
Viessmann Climate Solutions untersucht die Entwicklung von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden in Deutschland. Einige Städte legen demnach deutlich zu, andere bleiben weit zurück.
Die kommunale Energiewende kommt mit großen regionalen Unterschieden voran. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Unternehmens Viessmann Climate Solutions, die auf Daten des Marktstammdatenregisters basiert. Ein Jahr nach Inkrafttreten des Solarpakets I liegt demnach der Anteil von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden bundesweit bei 0,9 Prozent. Damit nimmt dieser Wert nach Unternehmensangaben gegenüber 2024 leicht ab, während die Zahl der privaten Installationen weiter stark steigt.
Viessmann Climate Solutions bewertet die Städte danach, welchen Anteil Anlagen auf kommunalen Dächern am gesamten Solarausbau vor Ort haben. Im Städtevergleich belegt Offenbach den ersten Platz. Dort erreichen Anlagen auf öffentlichen Gebäuden einen Anteil von 3,07 Prozent. In Tübingen beträgt der Anteil 2,8 Prozent, Böblingen kommt auf 2,76 Prozent. Beide baden-württembergischen Städte halten damit ihre Positionen in der Spitzengruppe. Laut Analyse stammen fast alle Städte in den Top 10 aus Baden-Württemberg oder Hessen. Diese Regionen nutzen ihre öffentlichen Flächen laut Unternehmen besonders aktiv für die Solarenergie.
Als deutlichen Aufsteiger nennt Viessmann Climate Solutions die Stadt Neuss in Nordrhein-Westfalen. Sie habe 2024 noch zu den Schlusslichtern gehört, aber 2025 ihren Bestand an Anlagen auf kommunalen Gebäuden mehr als verdoppelt. 30 neue Installationen gingen in Betrieb. Die Stadt verbessere damit ihre Platzierung im Ranking so stark wie keine andere Kommune im Untersuchungszeitraum.
Berlin weiter Spitze
Auch der Vergleich zwischen den Bundesländern zeigt laut Analyse unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Solarausbau. Berlin verteidigt demnach seine Spitzenposition mit einem Anteil von 1,26 Prozent und liegt damit knapp vor Baden-Württemberg mit 1,24 Prozent. Hessen folgt mit 1,17 Prozent. Brandenburg bildet weiter das Schlusslicht. Die dortigen öffentlichen Dächer tragen nur 0,47 Prozent zum gesamten Anlagenbestand im Bundesland bei.
Während einige Regionen den Ausbau auf ihren kommunalen Gebäuden deutlich voranbringen, zeigen die Zahlen laut Viessmann Climate Solutions auch, dass viele Städte mit dem Tempo privater Anlagen nicht mithalten. Der prozentuale Anteil der öffentlichen Dächer sinkt deshalb, obwohl neue Anlagen gebaut werden. Der Analyse zufolge bleiben in mehreren Kommunen die Potenziale ungenutzt.
Besonders auffällig seien Grevenbroich und Pulheim, beide in Nordrhein-Westfalen. Sie kommen jeweils auf einen Anteil von 0,21 Prozent und liegen damit am Ende der städtischen Auswertung.
Kommunale Gebäude könnten mehr profitieren
Viessmann Climate Solutions ordnet die Ergebnisse als Hinweis auf eine Herausforderung für die Kommunen ein. Private Haushalte und Unternehmen treiben den Solarausbau stark an. Doch für die öffentliche Hand komme es darauf an, eigene Gebäude stärker einzubeziehen, um einen sichtbaren Beitrag zur Energiewende zu leisten und Einnahmen zu erzielen. In vielen Städten gebe es weiterhin ungenutzte Dachflächen, die für Photovoltaik geeignet seien.
Die Analyse zeigt laut dem Unternehmen, dass der Standort eine wichtige Rolle spielt. Süddeutsche Städte setzen Solarenergie auf kommunalen Dächern häufiger um, während nördliche Regionen meist langsamere Zuwächse verzeichnen. Zudem wiesen Stadtstaaten wie Berlin strukturelle Vorteile auf, da sie viele öffentliche Gebäude besitzen und Entscheidungswege oftmals kürzer sind.
Unterschiede entstehen laut Viessmann Climate Solutions auch dadurch, dass Kommunen verschieden priorisieren. Manche setzten auf eigene Projekte und kommunale Energieversorger, andere unterstützen vor allem private Investitionen in Photovoltaik. Gleichzeitig bleibe der Fachkräftemangel im Elektrohandwerk ein limitierender Faktor, um geplante Installationen schnell umzusetzen.
Vorbildfunktion nutzen
Einig sind sich alle Beteiligten darin, dass die Nutzung öffentlicher Dächer eine Vorbildfunktion hat. Städte, die stärker investieren, könnten damit auch lokale Bürgerinnen und Bürger motivieren, selbst Anlagen zu errichten oder sich an Energiegenossenschaften zu beteiligen. Laut Analyse gibt es aber noch viele Kommunen, bei denen solche Effekte ausbleiben.
Viessmann Climate Solutions verweist darauf, dass weitere Maßnahmen nötig seien, um Genehmigungen und bauliche Prüfungen zu beschleunigen. Einige Projekte verzögerten sich, weil Abstimmungen zwischen verschiedenen Behörden lange dauerten. Die kommunale Energiewende brauche laut Einschätzung des Unternehmens Planungssicherheit und eine klare Prioritätensetzung, damit die Entwicklung in der Fläche vorankommt.
Die Ergebnisse der Studie „Solarausbau auf öffentlichen Gebäuden: Diese deutschen Städte führen 2025“ stehen auf der Internetseite von Viessmann Climate Solutions zur Einsicht bereit.
Autorin: Susanne Harmsen
Das könnte Sie auch interessieren
Bayern Innovativ Newsservice
Sie möchten regelmäßige Updates zu den Branchen, Technologie- und Themenfeldern von Bayern Innovativ erhalten? Bei unserem Newsservice sind Sie genau richtig!