Reaktortypen – Die unterschiedlichen Wege zur Kernfusion
Warum Fusion längst mehr ist als nur eine Vision
07.07.2025
100 Millionen Grad heißes Plasma, Laser, die winzige Wasserstoffkügelchen zünden, und Reaktoren in Donutform – die Wege zur kontrollierten Kernfusion könnten unterschiedlicher kaum sein. Ob mit starken Magnetfeldern im Tokamak oder durch Mini-Explosionen bei der Inertialfusion: Die Technologien konkurrieren um nichts Geringeres als die Energiequelle der Zukunft. Doch wie weit sind wir wirklich? Und welcher Ansatz hat das größte Potenzial? Antworten darauf erhalten Sie in diesem Interview mit Prof. Dr. Hartmut Zohm, Fusionsforscher am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.

Welche Reaktorkonzepte gibt es in der Fusionsforschung?
Prof. Dr. Zohm: Wir hatten in der letzten Folge schon drüber geredet, dass man ein Wasserstoffgas sehr stark erhitzen muss, bis zu 100 Millionen Grad, dann wird daraus ein sogenanntes Plasma. Dieses Plasma muss man einschließen. Letztlich unterscheiden sich die Konzepte grundlegend in der Idee, wie es eingeschlossen wird. Einerseits kann man starke Magnetfelder benutzen, um Plasmen, also Gase aus geladenen Teilchen, einzuschließen. Denn geladene Teilchen reagieren auf ein Magnetfeld und fahren auf ihren Bahnkurven längs des Magnetfelds. Das ist der sogenannte magnetische Einschluss. Man kann ein kleines Kügelchen mit Wasserstoff mit einem Brennstoff sehr stark erhitzen, sodass die äußere Schicht abdampft, den inneren Teil des Kügelchens komprimiert und so ähnliche Bedingungen wie in der Sonne entstehen lässt. Hierbei brennt das Kügelchen im günstigsten Fall ab und erzeugt mehr Energie als man hineingesteckt hat, um es zu komprimieren. Das ist eine miniaturisierte Explosion und in diesem Fall ist der Einschluss nur innerhalb von wenigen Sekunden-Bruchteilen und nur durch die Massenträgheit des auseinanderfliegenden Wasserstoffs oder Helium gegeben. Deshalb spricht man von Trägheits- oder Inertialfusion.
Bei der Magnetfusion gibt es zwei unterschiedliche Typen, die Tokamak und den Stellarator, wo liegen da die Unterschiede?
Prof. Dr. Zohm: Die beste Konfiguration, um ein Plasma einzuschließen ist eine, in der das Magnetfeld eine sogenannte Torusform hat. Dabei sieht der Behälter, in dem es eingesperrt wird, aus wie ein Donut oder ein Fahrradschlauch, je nach Abmessungen. Das macht man, um Endverluste zu vermeiden. Denn Teilchen laufen entlang des Magnetfeldes sehr schnell und immer im Kreis, dabei berühren sie nirgendwo die Wand. Tokamak und Stellarator sind solche toridalen magnetischen Einschlusskonzepte. Sie unterscheiden sich in der Art, wie man diesen Magnetfeldkäfig zum Einschließen der Teilchen macht. Beim Stellarator geschieht das nur mit externen Spulen. Also alle Elektromagnete, die das Feld erzeugen, sind extern und werden sozusagen um das Entladungsgefäß herumgebaut. Bei Tokamak ist das nicht so. Hier gibt es Teile des Magnetfelds, die extern mit Spulen erzeugt werden und andere Teile durch einen Strom, den man im Plasma fließen lässt. Dieser ist mit einer Million Ampere übrigens sehr stark. Das ist die typische Stromstärke in unseren Experimenten hier in Garching am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Somit kann der Generator stationär laufen, ohne weiteren Eingriff. Beim Tokamak muss man diesen Strom treiben und dafür sorgen, dass der Magnetfeldkäfig bestehen bleibt.
Welche der beiden Herangehensweisen würde sich besser für eine Anwendung in der Industrie eignen?
Prof. Dr. Zohm: Auf lange Sicht halte ich den Stellarator für deutlich besser geeignet, eben wegen dieser Stationarität. Da muss man von innen keine Ströme treiben und dem Plasma sozusagen nichts an freier Energie überlassen. Allerdings ist das Spulensystem des Stellarators deutlich komplexer. Deshalb sind die Stellaratoren in der technischen Evolution eine Generation hinter dem Tokamak. Aus diesem Grund sehen wir aktuell auch viele Tokamaks, beispielsweise beim ITER-Experiment aus Südfrankreich. Dieses wird wohl das erste Experiment sein, das diesen positiven Energiebilanznachweis führt. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird der Stellarator die Nase vorne haben.
Was genau passiert bei der Trägheitseinschlussfusion?
Prof. Dr. Zohm: Man braucht eine starke Energiequelle, welche die Energie möglichst sphärisch, also kugelsymmetrisch, auf das Kügelchen aufbringt. Dazu nimmt man typischerweise einen sehr starken Laser. Wenn man das Material außen verdampft, dann dampft es nach außen ab und erzeugt einen Rückstoß. Durch diesen Rückstoß wird das Material verdichtet und erhitzt, sodass es im Inneren ähnliche Verhältnisse wie im Inneren der Sonne gibt. Diese führen dazu, dass die Brennstoffe der Kernfusion miteinander verschmelzen.
Also ist die Herausforderung auf dem Weg zum Kraftwerk, einen hohen Druck und hohe Temperaturen herzustellen?
Prof. Dr. Zohm: Man muss ein bisschen vorsichtig mit dem hohen Druck sein. Das ist wahr für die Inertialfusion, bei der der Druck wirklich so hoch wie im Sonneninneren ist, weil die Materie stark verdichtet wird. Bei der Fusion mit magnetischem Einschluss, die stationär vor sich hinläuft, ist die Dichte, also die Anzahl der Teilchen im Volumen, eine Millionen Mal geringer als in unserer Umgebungsluft. Somit beträgt Druck etwas in der Größenordnung von ein paar Bar, also eine durchaus beherrschbare Anzahl, weil es eben im Magnetfeld eingeschlossen wird. Die andere Herangehensweise ist eher eine Explosion. Dabei läuft die Reaktion eher unkontrolliert ab und setzt die Energie frei.
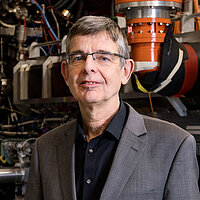
"Wir erwarten, dass ITER in den 2030er-Jahren erstmals zeigt, dass durch Fusionsreaktionen mehr Wärme freigesetzt wird, als zum Heizen und Aufrechterhalten der Plasmatemperatur aufgewendet werden muss."
Prof. Dr. Hartmut Zohm
wissenschaftliches Mitglied, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und Honorarprofessor, LMU München
Was steckt hinter dem Projekt ITER?
Prof. Dr. Zohm: ITER ist ein großes Projekt, welches von sieben internationalen Partnern in Südfrankreich, Cadarache, aufgebaut wird. Es handelt sich dabei um ein Tokamak. Es beruht also auf dem magnetischen Einschluss, weil dieser weiter fortgeschritten ist, auf dem Weg zur kontrollierten Kernfusion als Energiequelle. Wir erwarten, dass ITER in den kommenden 2030er Jahren zum ersten Mal zeigt, dass mehr Wärme durch Fusionsreaktionen freigesetzt werden kann, als man im Plasma deponieren muss, um es aufzuheizen. Das ist ein sogenanntes brennendes Plasma, da ist die Energiebilanz dann im Plasma positiv und im Wesentlichen selbst geheizt. Dafür ist ein Q-Wert von etwa zehn zu erreichen. Das ist das erklärte Ziel des ITER.
Wie sieht die Europäische Roadmap zu einem so funktionierenden Fusionskraftwerk aus?
Prof. Dr. Zohm: Also ITER ist das zentrale Element dieser Roadmap für die Magnetfusion. ITER wird den wissenschaftlichen Nachweis für einen gezündeten, sich selbst erhaltenen Plasmazustand bringen. Es gibt viele Technologiefragen, die man parallel dazu klären muss. Dafür muss man ein Demonstrationskraftwerk bauen, das all diese Kreisläufe zusammenschließt und so dann so viel Energie erzeugt, dass diese letztlich beispielsweise ins Netz eingespeist werden kann. Man sollte dazu sagen, dass diese Roadmap zunächst den Plan hatte, ITER und das Demonstrationskraftwerk sequenziell durchzuführen. Also ITER sollte den wissenschaftlichen Teil zeigen und dann bauen wir hinterher die Technologieexperiment-Demo. Mittlerweile wollen wir das so weit wie möglich parallelisieren, um schneller voranzuschreiten, weil wir auch aus ITER schon sehr viel über die Technologie gelernt haben. Es wird ja gerade zusammengesetzt, das heißt, die Teile sind zum größten Teil gefertigt. Man weiß also jetzt, wie man solche großen Magneten baut und wie man in einer nuklearen Umgebung die Technologie bauen muss, damit alles funktioniert. Und darauf kann man jetzt schon setzen.
Was passiert mit den anderen Technologien und Ansätzen, beispielsweise mit dem Stellarator?
Prof. Dr. Zohm: Also der Stellarator wird gerade in Deutschland als Alternative sehr stark verfolgt. Wir haben das weltweit größte Stellarator-Experiment, „Wendelstein 7-X“ in Greifswald. Dieses wird vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik betrieben. Der Stellarator wird weiter parallel betrieben. Aber es gibt aber Pläne und Forschung, um auch neue Experimente zu bauen, so dass man, wenn die Machbarkeit bewiesen ist, umsteigen könnte. Ich halte den Stellarator für das langfristig bessere Konzept. Damit man diesen Wechsel möglichst ohne Probleme beim Übergang hinbekommt, muss man eben jetzt schon daran forschen.
Ist die Inertialfusion an einem ähnlichen Punkt wie Tokamak und Stellarator angelangt, oder wo steht man hier?
Prof. Dr. Zohm: Die Inertialfusion hat in den letzten Jahren tolle Erfolge erzielt. So ein Kügelchen wurde bereits in den Bereich des Brennens überführt. Es gibt aber das Problem, dass in den letzten Jahrzehnten die Forschung an der Inertialfusion im Wesentlichen auf militärische Aspekte ausgerichtet war. Deshalb sind all diese Technologiekomponenten, die aber unheimlich wichtig sind und die wir bei der Magnetfusion eben schon entwickelt haben, lange nicht bei dem Reifegrad, der bei der Magnetfusion vorliegt. Und insofern denke ich, die Inertialfusion ist da, wo wir vor zehn bis 20 Jahren mit der Magnetfusion standen. Das muss noch aufgeholt werden. Ich denke schon, dass das in Zukunft möglich sein wird, aber es ist noch viel an Technologie zu untersuchen.
Bei der Magnetfusion wird davon ausgegangen, dass ein funktionierendes Kraftwerk im Jahr 2050 steht. Halten Sie das für realistisch?
Prof. Dr. Zohm: Das ist sehr ambitioniert. Es ist meiner Meinung nach möglich, wenn wir die Forschung weiterführen und ausbauen. Wir hatten bis jetzt ein Forschungsprogramm und man muss nun parallel dazu in ein industrielles Programm einsteigen, in dem man ein Ökosystem von Zuliefer-Industrien aufbaut, die die einzelnen Teile fertigen können und dann wahrscheinlich unter der Leitung eines großen Energieversorgers das Fusionskraftwerk bauen. Ich bin mit Zeitskalen immer ein bisschen vorsichtig, wir haben ursprünglich 20 Jahre für die deutsche Fusionsforschung geschätzt. Aber das sind 20 Jahre ab dem Tag, an dem Ernst gemacht und das nötige Geld auf den Tisch gelegt wird, um dieses Ökosystem zu schaffen. Nur durch die Verkündung, dass es noch 20 Jahre dauert, ist noch lange nicht gesagt, dass es in 20 Jahren auch fertig ist.
Wenn Sie den fertigen Reaktor taufen dürften, welchen Namen würden Sie ihm geben?
Prof. Dr. Zohm: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass der einen ganz unprosaischen Namen hat, beispielsweise XYZ1B oder etwas in dieser Art. Das wäre dann der Übergang von dem, was das Forschertum tut, nämlich ein wenig Namens- und Personenkult zu betreiben, hin zu dem, was industrielle Produkte in Großserie und Serienreife bedeuten. Insofern würde ich keinen Namen wählen, der besonders fantasievoll ist.
Entdecken Sie auch Teil 1 und Teil 3 unseres Interviews mit Prof. Dr. Hartmut Zohm, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das Interview führte Christoph Raithel, Referent der Geschäftsleitung, Bayern Innovativ GmbH, Nürnberg.
Länge der Audiodatei: 00:17:08 (hh:mm:ss)
Auf dem Weg zum Kraftwerk: Tokamak, Stellarator & Co? (28.05.2025)
Welche Reaktortypen gibt es? Wie sieht der Weg zum ersten Fusionskraftwerk aus? Die Antworten verrät Ihnen Prof. Dr. Hartmut Zohm, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Ihr Kontakt

